Zahlwörter und arabische Zahlen
Intermodale Integration und deren Beziehung zur Entwicklung der mathematischen Leistung
Zusammenfassung
Theoretischer Hintergrund:
Die Integration von Zahlwörtern und arabischen Ziffern ist bisher weitgehend unerforscht, stellt aber einen interessanten Prädiktor für die erfolgreiche Entwicklung mathematischer Fertigkeiten dar. In vorhergehenden Studien wurden dabei vor allem einstellige Zahlen herangezogen, um das Zahlenwissen zu erheben. Doch gerade das Verständnis des Stellenwerts bei mehrstelligen Zahlen dürfte laut neueren Erkenntnissen einen Einfluss auf die weitere arithmetische Entwicklung bei Kindern haben. Eine besondere Herausforderung beim Zahlenschreiben im Deutschen stellt die Zahlenreihenfolge dar. Die Zahl „vierundfünfzig“ wird zum Beispiel als 54 geschrieben. Im Gegensatz zur Arabischen Zahl kommt im gesprochenen Zahlwort zuerst der Einer und dann der Zehner. Dies ist eine Besonderheit, die nur in wenigen Sprachen auftritt und als Inversion bezeichnet wird. Im Englischen stimmt die Reihenfolge des Zahlwortes mit der geschriebenen Zahl überein: 54 wird als „fifty-four“ gelesen. Erste Studien zeigten, dass sprachspezifische Regeln einerseits das frühe Zahlenwissen beeinflussen und sich andererseits auf die weiteren Rechenfertigkeiten auswirken können.
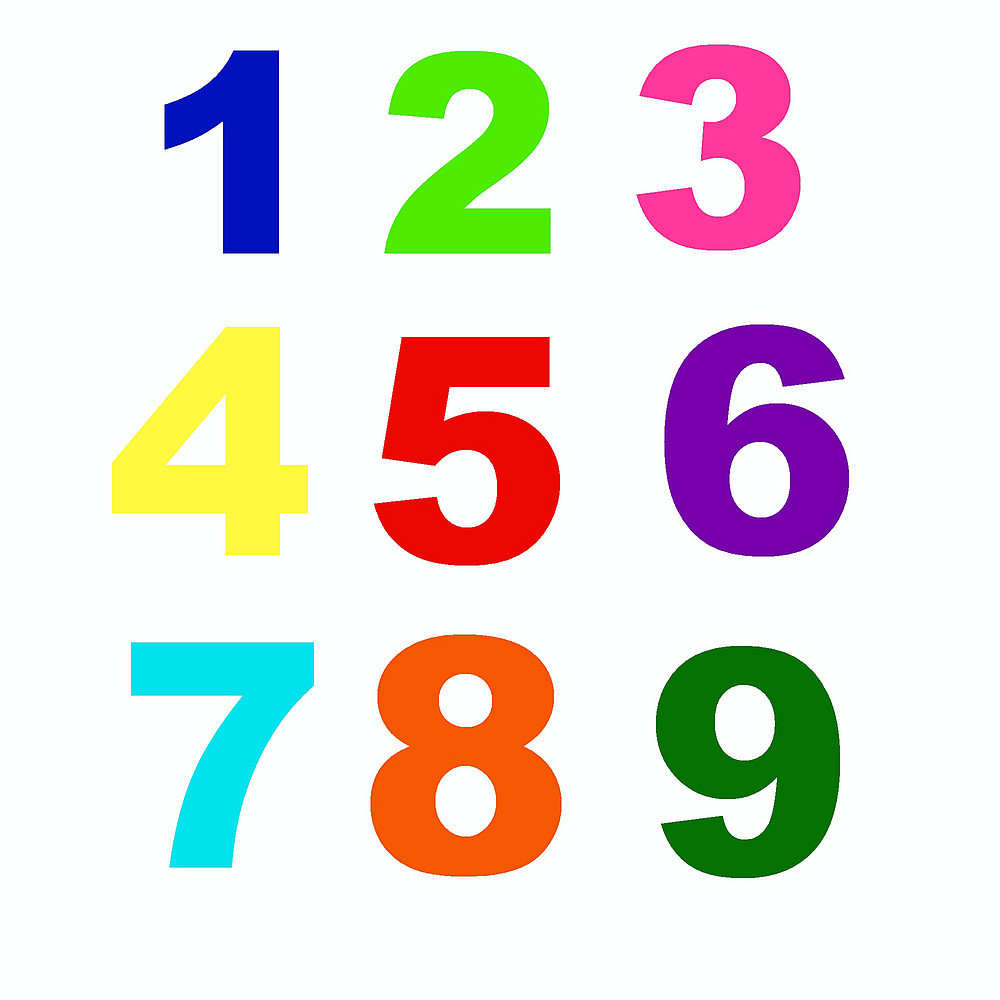
Ziele:
In diesem Projekt gingen wir der Frage nach, inwiefern die effiziente Integration von Zahlwörtern und arabischen Zahlen einen zuverlässigen Indikator der mathematischen Entwicklung in der Grundschule darstellt. Der Entwicklungsverlauf der Integration von Zahlwörtern und arabischen Ziffern und Zahlen sowie die Rolle sprachspezifischer Faktoren für den Integrationsprozess sollten untersucht werden. Dafür wurden Daten in den beiden Sprachen Englisch und Deutsch erhoben, deren Zahlwörter zwar sehr ähnlich sind, die sich aber im kritischen Merkmal der Zehner-Einer Inversion unterscheiden. Ziel war die Entwicklung eines differenzierten Modells der Integration von Zahlwörtern und arabischen Zahlen, welches auch die frühe Identifikation von Risikofaktoren für Probleme in der Entwicklung der mathematischen Leistungen ermöglicht.
Methode:
Die Forschungsinitiative wurde länderübergreifend mit Projektpartner:innen aus York (England) durchgeführt. Somit konnten Entwicklungsschritte in einer Sprache mit Inversion und einer Sprache ohne Inversion gegenübergestellt werden. In einer dreijährigen Längsschnittstudie wurden Kinder in Großbritannien und in Österreich vom Schuleintritt bis zum Ende der 3. Klasse (Sommersemester 2017, 2018, 2019) in ihrer Zahlenverarbeitung und mathematischen Entwicklung begleitet. Die Kinder wurden unter anderem gebeten, mehrstellige Zahlen niederzuschreiben, Zahlwörter arabischen Zahlen zuzuordnen, mehrstellige Zahlen laut vorzulesen und kurze Rechenaufgaben zu lösen. Außerdem wurden Aufgaben zum logischen Denken, Gedächtnis und zur Sprachlautverarbeitung durchgeführt. Die erhobenen Daten gingen anonymisiert in unsere Analyse ein.
In einem zweiten Forschungsstrang wurden querschnittlich mit Kindern der 2. und 4. Schulstufe sowie mit Erwachsenen in den beiden Sprachen detaillierte experimentelle und neurophysiologische (EEG-) Paradigmen zur numerischen Verarbeitung durchgeführt.
Ergebnisse der deutschsprachigen Erhebung:
Es gibt einen hohen Zusammenhang zwischen dem Zahlenlesen und dem Zahlenschreiben. Kinder, die viele Zahlen korrekt schreiben konnten, zeigten auch beim Zahlenlesen gute Leistungen. Da die Ergebnisse für das Zahlenlesen und -schreiben sehr ähnlich sind, werden wir uns im Folgenden auf das Zahlenschreiben konzentrieren.
Wir konnten bestätigen, dass die Leistung im Zahlenlesen und Zahlenschreiben sowohl in der ersten als auch in der zweiten Klasse mit der Rechenleistung zusammenhängt. Eine unsichere Leistung im Zahlenschreiben war mit einer schwächeren Rechenleistung assoziiert.
Unsere Analyse geschriebener und gelesener Zahlen bestätigte vorhergehende Studien, dass viele deutschsprachige Kinder in der ersten Klasse Schwierigkeiten mit der Einer-Zehner-Inversion haben. Die Inversion kann auch das Schreiben drei- und vierstelliger Zahlen beeinflussen, indem Kinder ihr erlerntes Wissen übergeneralisieren. Das heißt, sie stellen nicht nur den Zehner und Einer um, sondern auch den Hunderter und Tausender und die diktierte Zahl „dreihundertsechsundzwanzig“ wird zum Beispiel als 263 statt 326 geschrieben.
Weiterhin untersuchten wir, ob die Länge einer Zahl und/oder deren Struktur einen Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad haben. Dabei kamen wir zum Schluss, dass vielmehr die Zahlenstruktur als die Größe einer Zahl den Schwierigkeitsgrad ausmacht. Wir konnten z.B. zeigen, dass die Zahl 8000 (X000) viel einfacher zu schreiben war als die kleinere Zahl 870 (XX0). Dieses Ergebnis war sowohl in der ersten als auch in der zweiten Klasse beobachtbar. Es kommt also stark auf den Aufbau an und weniger auf die Größe einer Zahl.
Diese Erkenntnisse sind insofern wichtig, als dass man in Zukunft Kinder noch gezielter beim Lernen der Zahlen unterstützen kann, indem man insbesondere auf scheinbar schwierigere Zahlenstrukturen eingeht.
Kooperationspartnerin: Dr. Silke Göbel, University of York
Laufzeit: 01.04.2017 - 30.09.2021
Publikationen:
Banfi, C., Clayton, F.J., Steiner, A.F., Finke, S., Landerl, K., & Göbel, S.M. (2022). Transcoding counts: Longitudinal contribution of number writing to arithmetic in different languages. Journal of Experimental Child Psychology, 223, 105482. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2022.105482
Finke, S., Vogel, S.E., Freudenthaler, H.H., Banfi, C., Steiner, A.F., Kemény, F., Göbel, S.M., & Landerl, K. (2022). Developmental trajectories of symbolic magnitude and order processing and their relation with arithmetic development. Cognitive Development, 64, 101266. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2022.101266
Steiner, A.F., Finke, S., Clayton, F.J., Banfi, C., Kemény, F., Göbel, S.M., & Landerl, K. (2021). Language Effects in Early Development of Number Writing and Reading. Journal of Numerical Cognition, 7(3), 368-387. https://doi.org/10.5964/jnc.6929
Steiner, A.F., Banfi, C., Finke, S., Kemény, F., Clayton, F.J., Göbel, S.M., & Landerl, K. (2021). Twenty-four or four-and-twenty: Language modulates cross-modal matching for multidigit numbers in children and adults. Journal of Experimental Child Psychology, 202, e104970. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2020.104970
Finke, S., Banfi, C., Freudenthaler, H.H., Steiner, A.F., Vogel, S.E., Göbel, S.M., & Landerl, K. (2021). Common and distinct predictors of non-symbolic and symbolic ordinal number processing across the early primary school years. PLoS ONE, 16(10), e0258847. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258847
Finke, S., Kemény, F., Clayton, F.J., Banfi, C., Steiner, A.F., Perchtold-Stefan, C.M., Papousek, I., Göbel, S.M., & Landerl, K. (2021). Cross-format integration of auditory number words and visual-Arabic digits. An ERP study. Frontiers in Psychology, 12, e765709. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.765709
Clayton, F.J., Copper, C., Steiner, A.F., Banfi, C., Finke, S., Landerl, K., & Göbel, S.M. (2020). Two-digit number writing and arithmetic in Year 1 children: Does number word inversion matter? Cognitive Development, 56, e100967. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2020.100967
Finke, S., Freudenthaler, H.H., & Landerl, K. (2020). Symbolic processing mediates the relationship between nonsymbolic processing and later arithmetic performance. Frontiers in Psychology, 11, e549. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00549